Eine Kurzgeschichte von Stefan Kalbers
Wenn dies ein Comic wäre, sagen wir im Stil von Arne Bellstorf oder Adrian Tomine, dann bliebe nicht viel mehr als der schwache Versuch, den eigenen inneren Bildern Worte im Sinne einer Vorlage zuzuordnen, in der Hoffnung und dem guten Glauben, dass die Zeichnungen so viel mehr an Kraft und Atmosphäre haben, als es durch die diffuse Chiffrierung mit Buchstaben möglich ist. Die immerwährende Magie eines Bildes bleibt unschlagbar. Zeichner hätte man werden sollen. Oder sich zumindest einen bei Wasser und Brot im Keller halten. Wenn er dann brav die inneren Bilder genau so umsetzt, wie man sich das selbst vorgestellt hatte, wird dann auch schon mal die Kette am Fußgelenk von rechts nach links gewechselt.
Der innere Film zeigt also einen Mann oder einen kleinen Jungen, das weiß ich nicht so genau. Entweder ist der Mann ein handwerklich begabter Sonderling, der seine neueste Erfindung fertig in den Händen hält, oder der kleine Junge hat beim Spielen im Keller diesen Gegenstand hinter einem Schrank oder einer Kiste gefunden. Wie dieser Gegenstand aussehen soll, bleibt offen. Es handelt sich um eine Vorrichtung, mit der man menschlichen Schmerz im weitesten Sinne messen kann. Die Aufmerksamkeit liegt dabei auf der inneren, seelischen Not, im Sinne von Verzweiflung, Tragik und Hoffnungslosigkeit. Wie es sich anfühlt gegen einen Laternenpfahl zu laufen oder wie liebreizend die Empfindung anmutet, sich versehentlich mit dem Hammer auf den Penis zu schlagen, möge dereinst jeder für sich selbst herausfinden.
Ich bleibe jetzt doch lieber bei dem kleinen Jungen, weil er eine gewisse Unschuld und Naivität, gepaart mit unverbrauchter, natürlicher Neugier verkörpert. Der kleine Junge sitzt also im Treppenhaus dieses riesigen Wohnblocks, spielt mit seinem Fund, und eine Frau um die fünfzig mit grau gewordenen Haaren kommt die Treppen herunter. Abgetragene Kleidung, Falten um die Mundwinkel, die Augen stumpf, der Mund verkniffen. Nicht jedes Schicksal taugt zum Leinwanddrama, in dem selbst der größte Verlierer noch etwas vom Glanz großer Helden abbekommt. Die Wirklichkeit des Alltags zeichnet sich oft genug durch gnadenlose Schäbigkeit aus. Als die Frau wortlos an ihm vorübergeht bemerkt der Junge ein Vibrieren des Gegenstandes. Er verfärbt sich oder wird heiß. Die Haustür fällt ins Schloss, die Frau entfernt sich und der Gegenstand kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Wenig später holt der Junge sein Fahrrad aus dem Keller und radelt durch seine Wohngegend.
Als er an den Mülltonnen des Wohnblocks vorbeiradelt, sieht er einen Mann mit mehreren Stofftaschen, die an seinem Arm hängen. Der Mann durchwühlt die Container nach leeren Flaschen. Jede Art von Hemmung oder Scham ist ihm längst fremd geworden wie er so mit bloßen Händen im Müll anderer Menschen wühlt. Hat er eine Flasche gefunden, steckt er sie mit einem schabenden Geräusch zu den anderen in seinen Taschen. Mit etwas Glück hat er am Ende des Tages bis zu zehn Euro allein durch Pfand verdient. Es ist davon auszugehen, dass dieser Beschäftigung niemand wegen akuter Langeweile oder Geldgeilheit nachgeht. Da der Junge den Gegenstand auf seinen Gepäckträger geklemmt hat kann er nicht sehen, wie sich dieser verändert. Vielleicht könnte man den Schmerz des Pfandsammlers auch durch eine Verformung des Gegenstandes darstellen. Mir schwebt zum Abschluss dieser Szene auf jeden Fall ein Bild vor, wie der Mann mit unrasiertem Gesicht dem Jungen nachschaut. Dabei liegt die Qualität des Gesichtsausdrucks in seiner Unbestimmbarkeit. Ob gedankenverloren, sehnsüchtig oder gar hasserfüllt, muß offen bleiben.
Keine zweihundert Meter weiter kommt dem Jungen ein erwachsener Radfahrer entgegen. Die vollbepackten Spezialtaschen an dessen Rad, vor allem aber die orangefarbene Kleidung weisen ihn als Mitarbeiter einer dieser neuen Zustellfirmen aus, die der Post Konkurrenz machen und den Markt beleben sollen. Dass man mit solch einer Tätigkeit kaum seinen Lebensunterhalt verdienen kann, scheint kaum jemanden zu interessieren. Es wäre eine eigene Reportage wert, diesen Mann über den Zeitraum von einem halben Jahr zu begleiten. Was empfindet dieser Mann, wenn eine Kinoeintrittskarte mehr kostet als der Gegenwert von vier Stunden Arbeit? In was für eine Wohnung kehrt er abends nach Hause? Sanierter Altbau mit Zentralheizung auf über achtzig Quadratmeter wird es kaum sein. Familie gründen? Vergiss es. Du kannst eine Frau nicht mal zu einem stilvollen Abendessen einladen. Möglicherweise lässt sich der aktuelle Zeitbezug zu diesem Aufblühen der Billigjobs und dem damit verbundenen sozialen Elend aber nicht formvollendet in einen Comic einbauen. Entweder das Thema bleibt unverständlich oder wirkt vollkommen deplatziert. Vielleicht doch eher ein Fall für eine Fernsehreportage, die jeder, der nicht vom Thema betroffen ist, nach zwei Minuten wieder vergessen hat. Diese Art von Hoffnungslosigkeit konkret messen zu können, bleibt der Reiz des erfundenen Gegenstandes, den der kleine Junge mit sich herumträgt.
Bleiben zwei weitere Darstellungsprobleme zu behandeln. Zum einen würde ich gern in ein kleines Kind schauen können, wenn es zum ersten Mal in seinem Leben einen schlafenden Obdachlosen sieht. Da liegt ein verwahrloster Mann auf dem Boden vor einer Buchhandlung, weil deren Eingang überdacht ist. Umringt von vollgestopften Plastiktüten, einen üblen Gestank verbreitend. Die Schaufensterdekoration widmet sich einem Politik- oder Wirtschaftsspecial und wirbt für schlaue Zeitanalysen von Geistesgrößen wie Lothar Späth („Wir schaffen das“) oder Ulrich Wickert. Was genau passiert da, wenn das Kind zum ersten Mal begreift, dass ein Mensch bei jeder beschissenen Temperatur draußen schlafen muss, weil er kein Zuhause hat? Welche Erkenntnis wird hier gefördert, wenn man ihm erzählt, dass man sich an diesen Anblick gewöhnt, das halt nicht jeder so viel Glück im Leben hat, dass der Mann wahrscheinlich auch selbst Schuld hat, dass man sich an den Gewinnern, nicht an den Verlierern orientieren soll? Und doch bleibt beim Anblick eines auf dem Boden liegenden Menschen die Empfindung zurück: „Das könnte ich sein.“ Diese innere Erfahrung des Kindes lässt sich nur schwer darstellen und schon gar nicht unverbraucht. Wir leben im Jahr 2009. Jeder Versuch wirkt schon wie ein Klischee und albern. Wissen wir doch alles schon. Sozialromantik, Stoff aus dem vergangenen Jahrhundert, Pädagogikscheisse. Schreib nicht drüber, mach ganz konkret im Alltag was dagegen. Der Entertainer in uns würde ja auch viel lieber eine Karikatur daraus machen. Da hilft auch der herbeiphantasierte Gegenstand zur Schmerzmessung nichts. Auf der anderen Seite besteht die größte Freiheit bei allen Arten von schöpferischen Vorgängen in der vollkommenen Ignoranz der Geschichte. „Hey, schau mal, ich hab das Rad erfunden und das Feuer. Vielleicht werden die Menschen eines Tages zum Mond fliegen.“ Das kann natürlich nach hinten losgehen, aber prinzipiell darf und muss jeder den Ballast der Welt abschütteln und wieder ganz von vorne anfangen.
Das zweite Problem ist natürlich, dass sich Schmerz nicht ins Verhältnis setzen lässt. Beispiel: Einem Kind fällt eine Kugel Eis herunter, ein Erwachsener erfährt, dass sein linkes Auge für immer blind bleiben wird. Die Vernunft sagt uns, dass die medizinische Angelegenheit viel gravierender ist. Sie ist dauerhaft, beeinträchtigt den Alltag und lässt sich nicht rückgängig machen. Fragt man das Kind, so ist der Verlust der Kugel Eis für den Moment aber auch einem Weltuntergang ähnlich. Das Empfinden von Schmerz oder Verzweiflung kann auf einer persönlichen, ganz konkreten Erlebnisebene einfach nicht bewertet oder ins Verhältnis gesetzt werden. Schmerz bleibt Schmerz.
Der kleine Junge radelt also durch die Straßen seiner Wohngegend. Durch mehrere Einzelbilder wird dieser Lebensraum entsprechend charakterisiert. Durch die Art und den Zustand der Häuser, durch die Kleidung und das Alter der Menschen, die auf der Straße unterwegs sind. Man könnte ein paar Graffitti an den Wänden zeigen oder die Größe der Vorgärten mitsamt ihren Blumenbeeten, falls es denn solche geben sollte. Als der Junge an einer Einfahrt vorüberfährt muss er scharf bremsen. Aus dem Hinterhof schiebt sich langsam die Motorhaube eines größeren Wagens. Die Augen des Jungen blicken neugierig, was sich da an ihm vorbeischiebt. Der Wagen ist schwarz und auffallend sauber. Der Gesichtsaudruck des Jungen bleibt neutral und offen. Hinter dem Steuer sitzt ein Mann in Uniform und mit Mütze. Spätestens jetzt sollte jedem Bildbetrachter klar sein, dass es sich um einen frisch beladenen Leichenwagen handelt. Nachdem sich der Wagen entfernt hat und der Junge seine Fahrt wieder aufnimmt, erkennt man, dass der Gegenstand auf dem Gepäckträger plötzlich verschwunden ist, ohne dass man weiß, wie es dazu kam. Vielleicht ist er heruntergefallen. Hat man in den vorigen Bildern noch weitere Personen in unmittelbarer Nähe gezeigt, z.B. andere Kinder, könnte suggeriert werden, dass ihm der Gegenstand geklaut worden sei. Oder man zeigt schlicht, dass der Gegenstand kaputt gegangen ist. Wichtig ist allein der Bezug zwischen dem Leichenwagen, der den Tod symbolisiert, und der Möglichkeit, den Schmerz zu messen. Bleibt je nach persönlichem Gutdünken offen, ob der Tod das Ende aller Schmerzen bedeutet oder ob gesagt werden soll, dass das Ausmaß des Schmerzes durch den Tod so groß ist, dass es sich nicht ermessen und dadurch begreifen lässt. Soweit die vage Idee, der erste Notizzettel, für einen Comic zum Thema Schmerz. Zwingend überzeugend ist er nicht. Könnte man sich auch drüber lustig machen: „Der Mann mit dem Schmerzometer“ oder „Schmerzelrute – feel the pain, see the mess.“ Denkt natürlich sofort jeder an was Versautes. Ich glaube ich bestell‘ noch ein Bier. (Autor winkt mit dem Glas, Bedienung an der Theke nickt wissend zurück.) Hinten in der Ecke sitzt Julia mit ein paar Freunden. Die hat mich irgendwann einfach nicht mehr zurückgerufen. Das hat mich schon getroffen. Leichte Herzschmerzen sozusagen. Dabei ist sie nur beleidigt. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ihr neuer Freund in meinen Augen so eine Witzfigur ist. Einer dieser Typen, die in der Fußgängerzone barfuss und mit nacktem Oberkörper mit Kegeln oder Bällen jonglieren. Julia hatte mich angerufen, ich solle unbedingt kommen und mir das anschauen. Als guter Kumpel bin ich da natürlich hin und habe mich an die zwei Stunden dazu gesetzt. Warum auch nicht? Das Wetter war gut und ich hatte mich gefreut, Julia zu sehen. Der Typ hat dann wie wild jongliert. Das Gesicht verkniffen, die Rastas flogen hin und her, die Baggypants rutschten zusehends und dazu wurde eine Art wildes Rumgehüpfe geboten. Ich weiß nicht, ob das dazugehörte, aber dieser Tanz hat mich einfach an Rumpelstilzchen erinnert und das hab ich ihm auch gesagt. Außerdem ist ihm andauernd das Zeug runtergefallen. Er konnte seine Bälle keine zwanzig Sekunden am Stück in der Luft halten, sondern rannte unentwegt durch die Gegend, um sie wieder aufzusammeln. Als dann einer der Passanten noch eine Banane nach ihm warf, musste ich einfach lachen. Zugegeben, vielleicht habe ich ihn ausgelacht, aber erst als mich Julia mit ganz bösem Blick durchbohrte, dämmerte mir, dass sie etwas von diesem Typen wollte und natürlich Partei ergriff. Ich hatte mich schleunigst vom Acker gemacht und seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ob ich mal rübergehen sehen soll? Ne, lieber nicht. Ah, da kommt das Bier. Da fällt mir ein, dass jemand wie Helge Schneider möglicherweise sein ganzes Leben darunter leidet, dass niemand etwas Ernstes von ihm hören will. Seine reinen, seriös bemühten Jazzplatten kennt praktisch keiner. Als ganz großer Künstler geht nur durch, wer uns glaubhaft dramatischen Stoff andrehen kann. In diesem Sinne ist Helge eine tragische Figur. Ich stelle mir Helge vor, wie er auf die Bühne geht und sagt: „Hallo, ich bin’s, der Helge. Ich möchte gerne ernstgenommen werden.“ Der Komiker, der gern für voll genommen werden will – eine ganz eigene Kategorie in Punkto seelischer Schmerz.
Noch ein zweiter vager Entwurf zum Thema Schmerz schwebt mir vor. Diesmal im Stile eines Hollywoodfilms aus den Vierziger oder Fünfziger Jahren. Natürlich in schwarz-weiß gehalten und mit einer Mimik in den Gesichtern der Schauspielern versehen, wie ich sie zuletzt in „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ (1941) bei Spencer Tracy gesehen habe. Die Story könnte wie folgt aussehen: Ein kranker Mann ist dringend auf ein Spenderherz angewiesen und bekommt dies irgendwann auch. Dabei bleibt unklar, wer der tote Spender gewesen ist. Das Leben des operierten Mannes verläuft zunächst normal weiter, aber schließlich beginnt er aufgrund des neuen Herzens eine Veränderung in sich zu spüren.
Szene: Eine Frau sitzt weinend und zusammengekauert auf einer Bank. Sie springt hoch und läuft davon. In einer Seitenstrasse läuft der Protagonist ebenfalls zügigen Schrittes, da er es eilig hat. Die beiden laufen aufeinander zu, ohne es zu wissen. Schließlich, und das muss nicht genau an der Ecke sein, rempeln sie aneinander. Der Mann packt die Frau kurz an der Schulter, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren und in dieser Sekunde bemerkt er seine eigene körperliche Veränderung zum ersten Mal. Die Frau geht weiter ihres Weges. Wir kannten den Anlass ihrer Tränen nicht, aber wir sehen, dass sie jetzt langsam trocknen und sich ihre Gesichtszüge entspannen. Dem Mann hingegen geht es nicht so gut. Er muss sich setzen, beginnt zu schwitzen und schwer zu atmen. Nach einigen Minuten geht es auch ihm wieder besser und er kann seinen Weg fortsetzen.
Wie sich nach und nach herausstellt, bewirkt das neue Herz des Mannes einen sonderbaren Austausch. Bei jedem Menschen mit dem er in Berührung kommt, fließt die seelische Not, der psychische Schmerz auf den Mann über. Er saugt in gewisser Weise das Leiden der Menschheit auf oder anders ausgedrückt: Er nimmt das Leiden der Welt auf sich. Das dramatische Element an diesem Stoff ist der Tatsache geschuldet, dass es sich hier nicht um eine freiwillige Leistung im Sinne der Krankenkasse handelt. Der Mann hat keine Wahl. Er kann gar nicht anders. Zusehends wird seine innere Kraft weniger. Er magert körperlich ab, die Gesichtshaut fällt in sich zusammen. Ihm schwindelt angesichts des Ausmaßes an Leiden in der Welt. Verzweifelt über sein Unvermögen, mit offenem Herzen dem Leben gegenüber zu treten, geht er natürlich an diesem Schmerz qualvoll zugrunde. Ziemlich schnell sogar. Herr Ober, zahlen bitte!

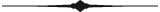
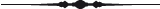





[...] Texte von Stefan Kalbers für BLANK: ICE Of The Living Dead Schmerz [...]