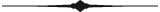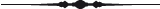Das Niemandsland. Ein nicht besiedeltes Territorium. Land, das keiner besitzt, kein Unternehmen oder Privatmann. Ein staatenloses Stück Erde. Meistens als Pufferzone zwischen verfeindeten Staaten, um Aggressionen zu drosseln.
In der Abgeschiedenheit der großen Wüste, zwischen der Westsahara, die seit dem Abzug der Kolonialmacht Spanien umkämpft und schlussendlich von Marokko annektiert wurde, und der Islamischen Republik Mauretanien, offenbart sich die ganze Trostlosigkeit eines solchen Nicht-Ortes. Eine vier Kilometer breite, seit dem Krieg zwischen Marokko, Algerien und Mauretanien mit Personen- und Fahrzeugminen verseuchte Demarkationslinie. Ein nicht zu umfahrendes Hindernis auf dem Weg von Marokko nach Dakar, der Hauptstadt des Senegal, in der mein Reisebegleiter Alex und ich unser Auto verkaufen wollen, um so die zweimonatige Reise von Berlin nach Schwarzafrika finanzieren zu können.

Das von den extremen Temperaturunterschieden, der sengenden Sonne und immer wieder vorüberziehenden Sandstürmen der Wüste zermürbte Zollhäuschen der Marokkaner wirkt wie die letzte Bastion der Zivilisation am Ende der Welt. Die nächste Stadt befindet sich eine Fahrt durch die Endlosigkeit der Wüste 380 Kilometer in nördlicher, sowie 45 Kilometer in südlicher Richtung, getrennt durch das Niemandsland. Hier scheint der Geburtsort der Tristesse. Und wie durch einen sonderbaren Zufall spricht der Zöllner ein paar Worte Deutsch. Er hat für einige Zeit in Frankfurt gelebt und will wissen, ob wir Bücher bei uns haben, die wir seinem Sohn schenken können, damit dieser deutsch lernen kann. Leider liest Alex auf englisch und ich habe die übersetzte Version des Don Quichote erst begonnen und verneine deshalb. Der Zöllner lächelt trotzdem, wuchtet den Ausreisestempel in den Reisepass und redet uns dann ins Gewissen: „Nicht Piste verlassen! Sonst ihr explodieren!“

Leichter gesagt als getan, denn die Piste besteht ausschließlich aus festgefahrenem Sand, kein Fladen von Asphalt weit und breit. Kurz nach dem Zoll erinnert die Piste noch an eine Fahrbahn, führt vorbei an Stacheldrahtverhauen, in dem sich der durch den starken Wüstenwind verwehte Müll verfangen hat, doch kaum ist der Zoll außer Sichtweite, fächert sich die Spur in mehrere auf und wird zu einer Art Labyrinth. So heften wir uns an die Stoßstange eines Kleinwagens, müssen ihn aber kurz darauf ziehen lassen, da unser alter Bus weniger wüstentauglich ist und durch die Schlaglöcher wackelt, dass wir Angst haben umzukippen. Schnell ist der Vordermann zwischen den Dünen unserem Blickfeld entwichen, verunsichert rollen wir nun voran, akribisch darauf achtend den festgefahrenen Sand vor uns zu entdecken. Zu oft überwiegt die Unsicherheit, was nun eigentlich Piste ist und was nicht. Jeden Moment rechnen wir damit, wie die französischen Touristen im Jahr 2007 auf eine Mine zu fahren und zu explodieren.
Es bleiben kurze Momente das Niemandsland zu begutachten. Die Umgebung scheint mir eine zur Realität erwachte Kulisse aus dem Spielfilm „Mad Max III – Jenseits der Donnerkuppel“. Apokalyptisches Szenario. Ausgeweidete Autowracks, teilweise mit Brandspuren übersät, stehen im Nichts der Wüste und sehen aus wie metallene Tierkadaver, die die Geier bis auf die Knochen abgenagt haben. Woanders wurden noch fahrtüchtige PKWs im Sand abgestellt, teilweise mit deutschem Nummernschild, doch vom Besitzer weit und breit keine Spur. Es handelt sich hierbei um gestohlene Autos, deren Fahrern die Einreise nach Mauretanien verweigert wurde und sie nun hier die Fahrzeuge ihrem staatenlosen Schicksal überließen. Dann wieder ein Reifenstapel zwischen Sanddünen, oder Kühlschränke, die im Schein der Wüstensonne funkeln, oder irgendwelcher undefinierbarer Metallschrott. Ich entdecke einen LKW, er muss auf eine Mine gefahren sein, der untere Teil der Fahrerkanzel ist durch eine Explosion vollständig zerstört. Es sieht fast so aus, als wolle der LKW im Sand verschwinden. Eines ist klar, niemand wird jemals den ganzen Müll entsorgen. Er gehört hier schließlich niemandem.

Nach einer gefühlten Ewigkeit entdecken wir die grüne Fahne mit dem gelben Halbmond und Stern der Islamischen Republik Mauretanien am Horizont. Unglücklicherweise hat sich eine viel zu lange Autoschlange vor dem Grenzübergang gebildet, da sich die Zöllner durch nichts aus ihrer Ruhe bringen lassen. Unbeeindruckt von den vielen wartenden Reisenden, gammeln die Zöllner gemütlich im Schatten eines Wellblechdaches, schütten Schwarztee von einem Glas in das andere, dann zurück in die verbeulte, blecherne Teekanne, um nochmals von vorne zu beginnen. Es kann sich also nur um Stunden handeln, bis wir an der Reihe sind, die unzähligen Grenzformalitäten zu erledigen.
Die unerträgliche Hitze in den stehenden Autos treibt alle nach draußen. Der scharfe Wüstenwind weht den feinen Sand wie durch einen Sandstrahler in jede kleinste Pore und schmerzt auf der Haut und in den Augen. Jeder sucht Schutz hinter der vom Wind abgewandte Seite seines Gefährt, unser Kleinbus wackelt in den Böen hin und her, die alte Federung quietscht. Fürs kleine und große Geschäft traut sich kaum einer weiter als 20 Meter Entfernung in die Wüste, zu groß die Angst vor Minenfeldern. Nur die ganz Wagemutigen suchen Blickschutz hinter einem ausgebrannten Audi, der etwa 50 Meter von der Piste entfernt seinem Schicksal überlassen wurde.

Stunden später, die Sonne neigt sich schon dem Horizont entgegen, dürfen wir die Grenze passieren. Dank Bakschisch, einem 20 Euroschein im Reisepass, beschleunigen wir die Arbeit der Zöllner. Diverses Papier wird von Hand zu Hand gereicht, weiteres Geld verschwindet in den Taschen der Uniformen, mit einer lapidaren Handbewegung werden wir zur Weiterfahrt aufgefordert. Wir sind eines der letzten Fahrzeuge, die an diesem Tag nach Mauretanien durchgelassen werden, bevor die Grenzposten früh Feierabend machen. Als wir wieder Asphalt unter den Rädern haben, denke ich an die anderen, die es heute nicht geschafft haben und nun die Nacht im Niemandsland verbringen dürfen. Unfreiwillige Protagonisten in einem wahr gewordenen Endzeit-Film.
Fotos: Alexander König