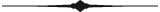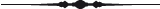Frauen und Bücher Teil 1
Vielleicht ist es ein etwas verzerrtes Bild, was uns da hohl anlächelt. Vielleicht ist es auch einfach nur Business. Auf jeden Fall wird es dem nicht gerecht, was im Allgemeinen und speziell im Besonderen so gedacht wird. Egal ob die Familienministerin ein verquertes Weltbild beschreibend versucht Politik für Frauen zu machen. Oder die ehemalige First Lady die eigene und die unbedarfte Gier ihres Göttergatten ausschlachtet. Oder Julia Schramm der Unwichtigkeit die Krone aufsetzt und sich selbst zu etwas stilisiert, was es gar nicht gibt. Es tut einfach nur weh. Und wahrscheinlich wird es so weitergehen, denn Verlage scheißen zur Zeit so ziemlich jede junge Frau mit einem Buchvertrag zu, die es halbwegs unverletzt bis hier hin geschafft hat. Zum Wunden lecken lässt man sie dann jedoch meist alleine. Doch um das Bild zu entzerren stellen wir in dieser und den nächsten Ausgaben Bücher vor, die dem, was wir als progressiv betrachten, etwas Nahrung geben. Bücher, die einladen und nicht abschrecken. Bücher, die es tatsächlich wagen oder gewagt haben, die Welt neu zu beschreiben.
Weiter
Angela McRobbie
„Top Girls Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes“
(VS Verlag)
Angela McRobbie ist Professorin für Kommunikationswissenschaften in London und beschreibt in ihrer lesenswerten Studie popkulturelle Spannungsverhältnisse, denen Frauen ausgesetzt sind und die feministisch degradierend Abhängigkeiten aufbauen, die in ihrem Erscheinungsbild so komplex sind, dass sie als diskriminierende Faktoren nur schwer zu erkennen sind. Unterhaltsam und lehrreich werden hier Filme und Ikonen zerpflückt, ohne all zu oft den Sinn für Konsum- und Alltagsrealitäten zu verlieren.
 Laurie Penny
Laurie Penny
„Fleischmarkt –
Weibliche Körper im Kapitalismus“
(Nautilus, 2012)
Die Autorin des populären Blogs „Penny Red“ beschäftigt sich in diesem schmalen aber wichtigen Buch mit den Mechanismen, die dafür sorgen, dass Frauen sich einem medial und marktwirtschaftlich entworfenen Ideal unterwerfen, ohne sich den Folgen dessen überhaupt bewusst zu sein. Penny seziert und entlarvt den kapitalistischen Geist der Bevormundung als Instrument der Machterhaltung und der Unterdrückung.
 Katja Kullmann
Katja Kullmann
„Echtleben“
(Eichborn, 2011)
Katja Kullmann beschreibt und inszeniert sich in diesem erfrischend lakonisch erzählten Buch als Frau im Strudel der Empfindsamkeiten im Leben der über 30jährigen, die vom Individualismus getrieben eine neue Dimension von Wertigkeiten entdeckt, die Bestehendes ergänzen, notfalls substituieren und wie der persönlichen Ausweg aus der Konformität nicht zwangweise in einer Sackgasse enden muss. Wir nennen das hier mal angewandte Theorie und empfehlen diese Buch dringendst Falls das jemanden zum Kaufentscheid bewegt: Es ist zuweilen sehr witzig. Stichwort ‚Emotionaler Klimawandel‘.
 Simone De Beauvoir
Simone De Beauvoir
„Das andere Gechlecht“
(Rowohlt, 1951)
Hipster-Grundlage und feministische Pflichtlektüre, zeitlos, intelligent, unnahbar. Simone De Beauvoir findet Worte und Sprache, von denen Feminismus noch lange zehren wird. Ihre Beziehung zu Sartre gilt als Musterbeispiel einer intellektuellen Ehe, radikal und idealisiert bis ins Letzte.
 Testcard Nr.8
Testcard Nr.8
„Gender – Geschlechterverhältnisse im Pop“
(Ventil Verlag, 2000)
Der in Popkultur verhaftete, aber immer wieder bieder wirkende Ventil Verlag aus dem provinziellen Mainz, hat immer wieder versucht Momente der Popkultur theoretisch aufzubereiten und zu analysieren. Mit am Besten gelungen ist es in der mehr oder weniger halbjährigen Buchmagazin-Reihe Testcard, speziell in der achten Ausgabe, die vor nun mehr als einem Jahrzehnt die interessantesten Diskursansätze in sich vereinte und zuweilen dem Ganzen den Hauch einer neuen Sprache zu geben schien. Hier schwankt man zwischen Tradition und Moderne und doch sind Texte über und mit Überschriften wie „Nur scharfe Girlies und knackige Boys? – Traditionelle und innovative Geschlechterbilder in Musikvideos“, „Harte Mädchen weinen nicht – Zum Umgang von Musikerinnen mit weiblichen Klischees“, „Nicht schlecht für eine Frau -Frauen als Produzentinnen von elektronischer Musik“ oder „Geschlechterverhältnisse und Gender-Debatte im Pop“ Pflichtlektüre für den Hipsternerdmetromacho von Heute.
 Hannelore Schlaffer
Hannelore Schlaffer
„Die Intellektuelle Ehe – Der Plan vom Leben als Paar“
(Carl Hanser Verlag, 2011)
Liebe sorgt zuweilen für eine Gleichberechtigung der Geschlechter, die gesellschaftliche Normen umgeht und bestenfalls ergänzend verändern lässt. Elisabeth Schlaffer zeigt auf und an wie es gehen könnte, sucht und findet historische Beispiele, gelungene, gescheiterte, meist Ansätze, die Unzulänglichkeiten offenbaren und dennoch demonstrieren, dass Partnerschaft in unserer heutigen Zeit mehr bedeuten kann, als die monogame Ehe zwischen Mann und Frau . Ein Buch zwischen historischer Suche und gegenwärtlicher Betrachtung.
 Diane Di Prima
Diane Di Prima
„Revolutionäre Briefe“
(Eco Verlag 1981 (Originalausgabe), aktuell erhältlich bei edition 8)
1971 erschien Diane Di Prima lyrische Anklage der amerikanischen Regierung und Gesellschaft bei City Light in San Francisco. Zu diesem Zeitpunkt war Di Prima, die in den 50er jahren in Beatnik-Kreisen um Kerouac und Ginsberg ihre Erweckung und kritisches Bewusstsein fand und in den 60ern in Timothy Learys LSD-Kommune lebte, bereits eine der meistgehörten Stimmen der Hippie-Bewegung. Di Prima hat fünf Kinder von vier Männern und ist Pflichtlektüre für den lyrisch-emotionalen Ruck.
 Eva Illouz
Eva Illouz
„Warum Liebe weh tut“
(Suhrkamp, 2012)
Illouz untersucht die Liebe als soziologisches Phänomen wie Marx einst die Ware im Kapitalismus. Dabei verliert sie jedoch weder den Menschen als individualisierte Funktionseinheit aus dem Blick, noch die Kraft der Romantik. Illouz beschreibt den modernen Menschen, ohne Allüren, ohne Besserwisserei.
(Teil 2 folgt)
Elmar Bracht
Dieser Artikel als Link: http://www.blank-magazin.de#859